Wie beatme ich bei COVID-19 mit ARDS?
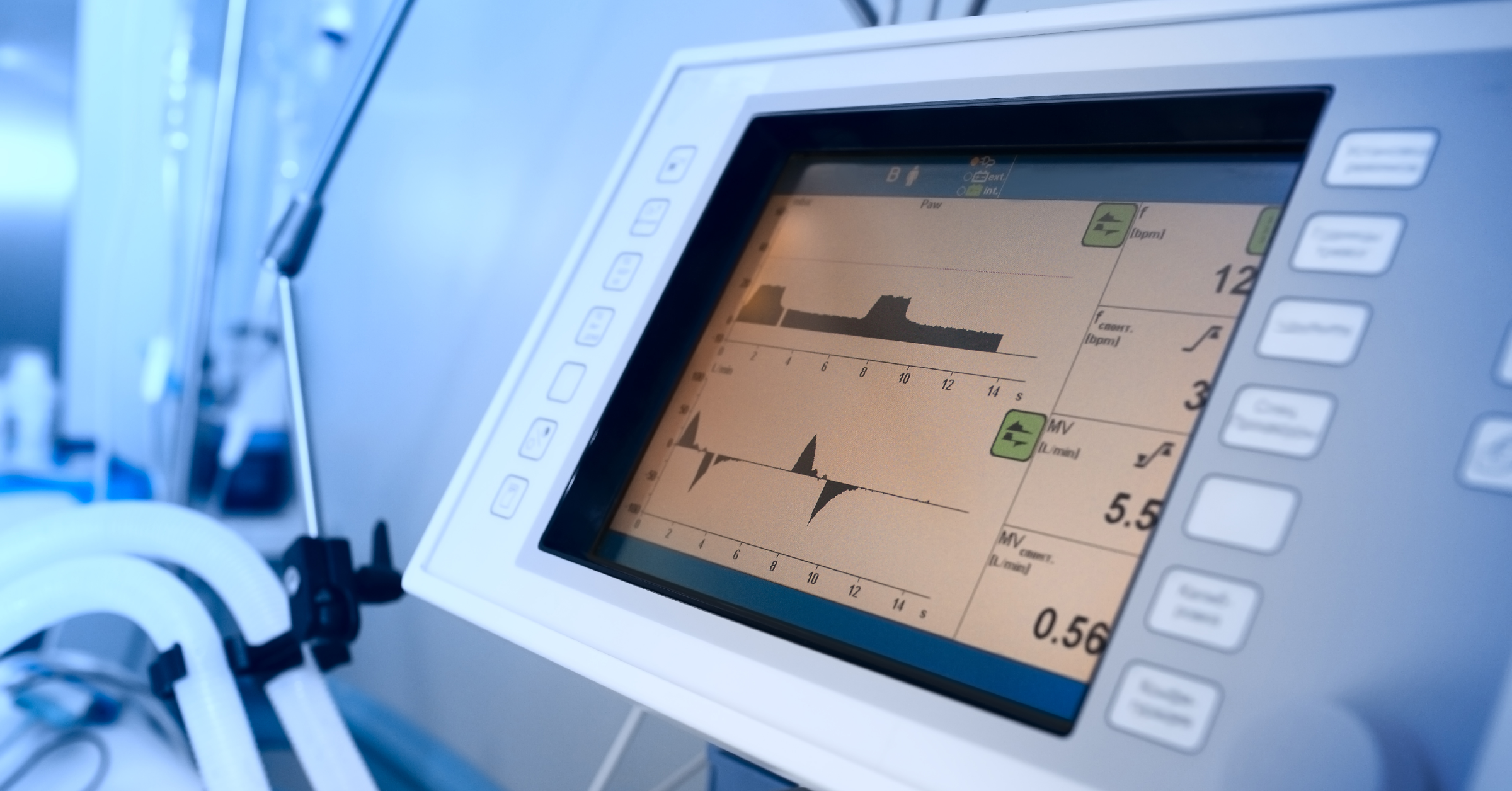
Pandemie und Personalmangel: Wie gelingt es auch weniger Erfahrenen, COVID-19-Erkrankte mit ARDS zu beatmen? Dr. med. Benjamin Junge erklärt Durchführung und Grundlagen.
--- Dieses Transkript gibt unsere beiden Podcast-Folgen (Teil 1 und Teil 2) mit Dr. med. Benjamin Junge im Wortlaut wieder. Sprachliche Ungenauigkeiten bitten wir vor diesem Hintergrund zu entschuldigen. Wir haben dieses Gespräch im März 2020 aufgezeichnet. Während die Grundlagen der Beatmung weiterhin gültig sind, gibt es unter anderem zur Begleittherapie inzwischen neue Erkenntnisse, die in der S3-Leitlinie zu finden sind. ---
AMBOSS: Bei der Beatmung eines Patienten befindet sich der behandelnde Arzt ja oft in einer sehr komplexen und herausfordernden Situation. Oft mit Zeitdruck verbunden, kann es enormer Stress sein, vor dem Beatmungsgerät zu stehen – dann noch mit schlechten BGA-Werten in der Hand – und sich ad hoc zu überlegen, welche Einstellungen oder Maßnahmen jetzt vorzunehmen sind, um die Situation zu verbessern. Ich denke, für so eine Situation ist es hilfreich, wenn man ein grobes Verständnis dafür hat, wie Atmung und Beatmung eigentlich auf physiologischer Ebene funktionieren. Wenn ich das verstanden habe, kann ich mir auch besser merken bzw. im Fall der Fälle herleiten, an welchen Stellschrauben ich drehen muss, wenn sich mein Parameter XY verändert hat. Deswegen würde ich gerne, bevor wir über die konkrete Durchführung sprechen, noch mal einen Schritt zurückgehen und mit dir über die Grundlagen sprechen. Wie funktioniert Beatmung im Vergleich zur normalen physiologischen Atmung?
Dr. med. Benjamin Junge: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, dass wir einmal den Unterschied zwischen der Physiologie – also sprich das, was wir jeden Tag machen, nämlich das Atmen – und der Beatmung verstehen, was im Endeffekt nichts mehr mit Physiologie zu tun hat. Und dass wir verstehen, welche Stellschrauben wir bei der Physiologie jeden Tag nutzen, die wir dann bei der Beatmung simulieren. Und wichtig: Wir wollen jetzt ja keine Physiologievorlesung daraus machen, sondern es geht darum, dass wir plakativ verstehen, was da einfach passiert.
“Wenn wir in Stress geraten, holen wir plötzlich viel tiefer Luft und atmen auch aktiv aus.”
Bei der normalen Atmung erzeugen wir einen Unterdruck im Brustkorb, häufig einfach dadurch, dass sich unser Zwerchfell kontrahiert und sich Richtung Abdomen bewegt. Und zusätzlich nutzen wir auch unsere Atemhilfsmuskulatur, indem wir die Rippen ein Stück weit senkrecht aufstellen und dadurch zusätzlich noch einen Unterdruck im Brustkorb erzeugen. Und durch den Unterdruck, den wir im Brustkorb erzeugen, strömt dann die Luft an unserer Stimmbandebene vorbei in die Lunge und kann so am Gasaustausch mit dem Blut teilnehmen. Wenn wir normal Luft holen – in aller Ruhe, sage ich jetzt mal – dann atmen wir relativ flach. Wir haben keinen großen Sauerstoffbedarf. Es wird nicht viel CO2 produziert und wir behalten einen gewissen Teil Luft auch in der Lunge zurück, den wir theoretisch noch weiter ausatmen könnten, wenn wir jetzt in Stress – bei Sport, Wehrreaktion oder sowas – geraten. Und das Volumen, das insgesamt zurückbleibt, an dem permanent auch Gasaustausch stattfindet, die sogenannte funktionelle Residualkapazität, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir später bedenken müssen. Wenn wir jetzt in Stress geraten – ich sage mal ganz einfach durch Sport – können wir plötzlich unser Atemminutenvolumen deutlich steigern, also das, was sich aus der Atemfrequenz und unserem Atemzugvolumen ergibt. Und da hole ich viel tiefer Luft und ich atme plötzlich auch aktiv aus. Normalerweise ist das mehr so eine Art passiver Vorgang; die Luft strömt einfach durch die Rückstellkräfte des Gewebes wieder raus. Und plötzlich fange ich an, im Bauch zu pressen und mit der Hilfsmuskulatur die Luft auch aktiv herauszubewegen. Und plötzlich kann ich sehr, sehr hohe Atemfrequenzen erreichen und auch ganz andere Tiefen.
Was wir pathologisch häufig als Kompensationsmechanismus sehen, ist die sogenannte Kußmaul-Atmung, bei den Patienten mit Ketoazidose, die ganz tief und ganz viel atmen. Die können über ihre Respiration erst mal sehr viel an metabolischer Azidose ausgleichen. Und wenn ich Luft hole, hat es nicht nur eine Auswirkung auf die Luft, die in den Brustkorb reinströmt, sondern, wenn ich tief oder auch normal Luft hole, dann strömt sogar mehr Blut zum Herzen zurück, weil im gesamten Brustkorb der Unterdruck ist und der auch auf die Hohlvene wirkt und ich damit Blut zurückziehe. Und das ist erst mal so, ganz einfach gesagt, das, was wir uns vorstellen müssen, wie wir jetzt alltäglich Luft holen, ohne dass wir ein Problem haben.
“Bei der künstlichen Beatmung muss ich Überdruck in den Thorax bringen – das ist ein ganz großer Unterschied”
AMBOSS: Alles klar. Und im Vergleich dazu: Wie sieht es jetzt bei einer kontrollierten maschinellen Beatmung aus?
Junge: Wir müssen uns erst einmal den Patienten vorstellen, der von uns jetzt eine kontrollierte, invasive Beatmung bekommt. Das ist klassischerweise ein Patient, der von uns auch eine Narkose bekommt. Narkose bedeutet: Der Patient soll schlafen, er soll keine Schmerzen haben und zusätzlich ist womöglich auch noch die Muskulatur relaxiert; sie ist quasi durch Medikamente gelähmt, um es ganz plakativ zu sagen. Und jetzt ist es so, dass wir über einen Schlauch, der in der Luftröhre liegt, den sogenannten Tubus, mit einem Beatmungsbeutel oder einem Beatmungsgerät einen Überdruck anlegen. Wir programmieren das Gerät und sagen: "Okay, du sollst für eine Sekunde oder für zwei Sekunden einen Druck von – plakativ gesagt – 15 Millibar aufbauen und danach soll dieser Druck wieder abfallen." Und dann können wir dem Gerät auch sagen, auf was für ein Druckniveau das jetzt herunterfallen soll. Das ist der sogenannte PEEP; das ist der Druck, der am Ende der Ausatmung zurückbleibt. Das ist der Positive End-Expiratory Pressure. Und das Niveau ist das Entscheidende, was wir am Ende, nämlich für die funktionelle Residualkapazität, einmal besprechen müssen. Und ich sage natürlich auch, wie häufig das Gerät beatmen soll oder wie häufig ich das selber beim Beatmungsbeutel mache. Also der ganz große Unterschied ist: Plötzlich muss ich Überdruck in den Thorax bringen, nämlich über ein Beatmungsgerät, und ich habe keinen Unterdruck mehr im Brustkorb. Das sind die ganz großen plakativen Unterschiede.
AMBOSS: Und du hast ja auch schon angesprochen: Der Patient befindet sich in Narkose. Was passiert denn mit dem Atmungsorgan, wenn ich eine Narkose erhalte?
Junge: Im ersten Moment passiert nämlich gar nichts mehr. Also sprich, die Muskulatur arbeitet nicht mehr. Und wenn ich jetzt einen Patienten vor mir liegen habe, der eine Narkose hat, ohne dass ich ihn intubiert habe, dann ist die Muskulatur erschlafft und die Organe, gerade die abdominellen Organe, sacken natürlich Richtung Rücken – der Rücken ist irgendwann eine Bremse – und dann kann das Ganze noch Richtung Zwerchfell, Richtung Brustkorb hoch drücken. Und auch das Gewebe, das auf dem Brustkorb ist – die Brustmuskulatur, das Drüsengewebe und auch Fett – das drückt jetzt alles auf den Brustkorb. Das heißt, das sackt alles zusammen und die sogenannte funktionelle Residualkapazität ist also deutlich geringer. Das ist das Volumen, an dem permanent Gasaustausch stattfindet, obwohl ich nicht gerade ein- oder ausatme. Und was dann passiert: Wenn Gewebe über das Zwerchfell Druck auf die Lunge ausübt, bilden sich sogenannte Atelektasen. Atelektasen sind Bereiche, in denen die kleinen Alveolen – das ist das, wo der Gasaustausch stattfindet – plötzlich zusammengedrückt werden. Das kann sein, dass die Alveole einfach viel kleiner wird. Und wir müssen uns das ja millionenfach vorstellen: nicht nur die einzelne Alveole, sondern Millionen Alveolen. Die werden entweder kleiner oder sie werden sogar richtig zusammengedrückt, sodass da gar keine Luft mehr drin ist. Dann kommt da zwar noch Blut dran vorbei, aber es gibt eben gar keinen Gasaustausch mehr, weil keine Luft da ist. Und da müssen wir jetzt gegen anarbeiten.
Die Lunge ist wie ein Luftballon: “Ich muss immer mehr Druck aufbauen – und plötzlich wird es ganz leicht”
AMBOSS: Alles klar – und dafür ist eben der Überdruck nötig, im Vergleich zur physiologischen Atmung, wo wir mit Unterdruck arbeiten: einmal, um gegen den Zustand durch die Narkose anzukämpfen und einmal, um die Alveolen, die jetzt kleiner werden oder sogar zusammenfallen wollen, aufzuhalten, und eben noch einen Gasaustausch zu bewerkstelligen. Richtig?
Junge: Genau, das ist korrekt. Also, wir legen einen Druck in der Lunge an und jetzt ist es so, dass die Lunge ja nicht nur aufgepustet wird. Wir müssen uns die Alveole und den Brustkorb wie einen Luftballon vorstellen: Wir wollen das mit Überdruck aufpusten. Aber wir müssen damit auch noch Gewebe wieder verdrängen, sprich: Normalerweise zieht sich das Zwerchfell aktiv Richtung Abdomen zusammen und drückt damit die inneren Organe auch ein bisschen beiseite. Das müssen wir jetzt mit der Lunge machen, was eigentlich ein sehr weiches, empfindliches Gewebe ist. Das pusten wir auf und das drückt den Brustkorb auf und sogar die inneren Organe beiseite. Und was wir jetzt bedenken müssen, das hast du auch schon gesagt: Wir wollen verhindern, dass sich diese kleinen Atelektasen bilden. Und das verhindern wir, indem wir immer ein Mindestmaß an Druck im Brustkorb zurücklassen, also den PEEP einstellen. Wir beide, wenn wir jetzt ganz normal Luft holen, steuern das halt selber. Wir können auch einen Glottisschluss machen und wir können sogar auch stark pressen. Das sind ganz andere Mechanismen, die wir nutzen können. Jemand, der eine Narkose hat, kann das nicht. Und die ersten Atelektasen, die bilden sich bei jemandem, der auf dem Rücken liegt, dorsobasal, also im Rückenbereich; da, wo die Lunge Kontakt zum Rücken hat. Und natürlich auch da, wo die inneren Organe am Zwerchfell Richtung Thorax drücken, bilden sich unsere Atelektasen. Und wenn ich den richtigen PEEP wähle, dann verhindere ich, dass die Alveolen übermäßig zusammenfallen. Und dann kann ich mit dem Tidalvolumen – das ist das, was ich an Beatmungsvolumen jedes Mal wieder in den Brustkorb gebe – einen Gasaustausch garantieren. Und jetzt kommt natürlich die Frage: "Okay, wie viel PEEP soll ich denn einstellen? Denn woher kommt die Vorstellung, was ich brauche und was ich nicht brauche?" Und man muss sich erst mal den Brustkorb wie einen Luftballon vorstellen; das habe ich schon gesagt. Und jetzt legen wir Druck an diesen Luftballon an. Jeder kennt das selber, wenn er mal einen Luftballon aufgepustet hat: Ich fange an zu pusten und am Anfang habe ich das Gefühl, es passiert überhaupt nichts und ich muss immer mehr Druck aufbauen. Und plötzlich habe ich am Luftballon ein Volumen erreicht, da wird es ganz leicht, da kann ich plötzlich den ganzen Luftballon aufpusten und der Widerstand ist plötzlich weg. Und so ähnlich passiert das auch übertragen auf die Lunge, den Thorax und auf die kleine Alveole. Ich muss ein Mindestvolumen in der Alveole und im Brustkorb zurücklassen, bevor ich zu wenig im Brustkorb zurücklasse. Dann würde der Luftballon wieder zusammenschnurren und so klein sein, dass ich wieder diesen riesigen Energieaufwand brauche, um die Lunge und den Luftballon zu öffnen.
AMBOSS: Das heißt, ich muss den PEEP so wählen, dass er über der Grenze ist, bis zu der es schwer ist, diesen Luftballon aufzupusten. Und das ist quasi mein Minimum; da muss ich die Lunge halten und dann kann ich einfacher durch die druckkontrollierte Beatmung Luft rein- und rauslassen. Und jetzt ist die Kunst, diesen PEEP zu finden, weil der natürlich nicht bei jedem Patienten derselbe ist. Du hattest bei der physiologischen Atmung auch noch die Hämodynamik angesprochen, nämlich, dass aufgrund des Unterdrucks im Brustkorb aus der Hohlvene verstärkt Blut ins Herz zurückfließt. Wie sieht es denn jetzt bei der Beatmung aus? Da habe ich ja zu keinem Zeitpunkt einen Unterdruck.
Junge: Ja, das ist absolut richtig. Ich mache nur einen ganz kurzen Sprung zurück dahin, was du gerade zu dem PEEP sagtest. Den Punkt zu finden, dass der Luftballon oder der Brustkorb nicht wieder zu wenig Luft drin hat, das nennt man pathophysiologisch den unteren Inflektionspunkt. Und dieser untere Inflektionspunkt ist einer der Punkte, die wir uns beim PEEP zunutze machen. Wir kommen später beim ARDS und der Pathophysiologie noch dazu, was der PEEP eigentlich noch alles macht. Also, es macht Sinn, mehrere Punkte gleich am Ende zu betrachten.
“Wenn ich kontinuierlich Überdruck im Brustkorb habe, strömt weniger Blut zurück zum Herzen.”
Jetzt aber einmal auf die Hämodynamik bezogen: Das ist korrekt. Wenn wir ganz normal Luft holen, habe ich einen Unterdruck im Brustkorb und ich ziehe in dieser Phase des Unterdrucks aktiv noch mehr Blut zum Herzen zurück. Wenn ich kontinuierlich einen Überdruck im Brustkorb habe – also, wir haben einen PEEP eingestellt und es ist womöglich auch noch ein relativ hoher PEEP, weil ich den für meine Beatmungssituation und für die respiratorische Störung benötige – dann bedeutet das, dass weniger Blut zum Herzen zurückströmt, weil ich einen Überdruck habe. Also das, was ich beim Unterdruck habe, dass mehr zurückströmt, bedeutet beim PEEP, dass weniger Blut zurückströmt. Und das kann ein Vorteil sein, weil ich sage: "Okay, der Patient hat eine Hypervolämie oder das Herz hat akut eine so große Insuffizienz entwickelt, dass ich es nicht mit dem Volumen überladen möchte." Es kann aber auch ein Stück weit ein Nachteil sein, wenn ich einen Patienten mit einer Hypovolämie habe – sprich: zu wenig Flüssigkeit im Körper – und jetzt auch noch den venösen Rückstrom bremse. Das muss ich einfach bedenken. Es hat ein, zwei Konsequenzen, sodass ich vorsichtig vorgehe. Aber es soll mich auch nicht ausbremsen, sodass ich zu viel Angst habe, jetzt einen PEEP zu nutzen. Da kommen wir ja gleich beim ARDS darauf zu sprechen, warum es wichtig ist, dass ich das im Hinterkopf behalte.
“60% aller ARDS entstehen durch eine Pneumonie.”
AMBOSS: Ich würde sagen, dann kommen wir auch gleich auf das ARDS, weil das, was wir jetzt besprochen haben, ist ja eine Beatmungssituation bei einem gesunden Patienten, der einfach nur in Narkose ist. Jetzt kommt auch noch dazu: Dieser Patient ist krank. Er hat in unserem Fall bei einem schweren COVID-Verlauf ein ARDS entwickelt, also ein Acute Respiratory Distress Syndrome. Was passiert denn bei einem ARDS in der Lunge? Und bei einem ARDS ist es ja unerheblich, durch welchen Trigger, durch welche auslösende Noxe das ARDS jetzt entstanden ist, richtig?
Junge: Ja, das ist korrekt. Also, wir wissen, dass ungefähr 60 Prozent aller ARDS durch eine Pneumonie entstehen, aber wir haben auch sehr, sehr viele unterschiedliche andere Trigger. Wir wollen jetzt den Schwerpunkt darauf setzen, was bei einem Patienten ist, der COVID-19 hat. Das heißt, wir lassen die Polytrauma-Patienten raus, die andere Operationen hatten, die eine Sepsis aufgrund eines Infektes haben. All die sind erstmal ausgeklammert aus dem Bereich. Wir wollen primär den COVID-Patienten mit ARDS und das ARDS an sich besprechen. Das wäre auch wichtig zu verstehen, wenn man diesen Podcast hört und sagt: "Ich interessiere mich auch ein bisschen für weitere Dinge." Wir wollen es hier plakativ beschreiben. Wir sind kein Journal Club; es ist kein Kongressbeitrag. Wir wollen verstehen, was es ist.
Und das ARDS ist eine unspezifische Entzündungsreaktion in der Lunge. Und das bedeutet, dass wir durch neutrophile Granulozyten und durch Zytokine plötzlich das haben, was immer bei Entzündungsreaktionen passiert: Es entwickelt sich ein Ödem. Und dieses Ödem entsteht in der Lunge einmal interstitiell, aber auch intraalveolär. Und das Ganze ist dazu auch noch proteinreich. Und wir wissen, Proteine bedeutet immer: Das zieht auch Wasser. Und Proteine können auch immer ein Stück weit Dinge zerstören. Und beim ARDS ist es so, dass die Proteine einmal Wasser ziehen; das heißt, ich habe ein Ödem, das immer mehr wird, und es zerstört den Surfactant. Und der Surfactant ist ja entscheidend dafür, dass die Alveole durch die Oberflächenspannung immer geöffnet bleibt. Wenn ich jetzt also jemanden habe, der keine gute Surfactant-Wirkung mehr hat, dann entwickeln sich überall ganz feine Atelektasen in den einzelnen Alveolen.
Zusätzlich verlängert sich durch das Ödem, also Wasser in der Alveole, die Diffusionsstrecke für Sauerstoff und für Kohlendioxid. Das zeigt sich dann mit unseren Problemen, die da kommen. Und dann wird ja die Lunge auch noch schwer dadurch, dass sich Wasser als Ödem anlagert. Das heißt, sie wird nass und schwer. Und wenn wir uns jetzt diesen Patienten vorstellen, der auf dem Rücken liegt, dann sackt natürlich dieses Gewicht der Lunge wie ein Schwamm zusammen und die Atelektasen bilden sich immer stärker. Im Verlauf entwickelt sich dann durch Fibrosierung eine Steifigkeit der Lunge. Das ist dann aber eher so ab Tag 3, dass sich das entwickelt. Das heißt, die Lunge baut sich dann um und das sind dann ganz andere Probleme, die noch zusätzlich entstehen.
“Die atmen, atmen, atmen.”
Und was ich natürlich immer habe, wenn ich einen Bereich in der Lunge habe, der Atelektasen entwickelt und einen Bereich, der keine Atelektasen entwickelt: Es verändert sich auch die Durchblutung der Lunge. Also wir haben ein Stück weit die hypoxische Vasokonstriktion, das heißt: Ein Bereich, in den durch die Atmung wenig Sauerstoff hinkommt, wird in der Lunge weniger durchblutet. Das ist ein physiologischer Reflex und der macht Sinn. Irgendwann schafft dieser Reflex es aber nicht mehr zu kompensieren und ich habe viele Bereiche, die zwar nicht mehr ventiliert werden, aber weiterhin vom Herzen perfundiert werden. Und das heißt, ich bewege Blut daran vorbei, aber es kann gar keinen Sauerstoff mehr aufnehmen und kein Kohlendioxid abgeben, weil in dem Bereich gar keine Ventilation stattfindet. Und das ist das Allererste, was passiert, rein auf die Entzündung des ARDS bezogen. Und wenn sich die Strecke der Diffusion verlängert, dann ist es für den Sauerstoff – der nun mal auch einen ganz anderen Diffusionskoeffizienten hat – deutlich schwieriger, aus der Luft in das Blut zu kommen. Für das CO2 kommt das erst ein bisschen später zum Tragen, weil die Diffusion dort nun mal ein bisschen besser ist. Wir sehen das bei den Patienten immer ganz schnell, dass sie erstmal viel Atemfrequenz und auch Atemtiefe aufbauen. Die atmen, atmen, atmen.
AMBOSS: Ja, atmen, atmen, atmen und das heißt – wir erinnern uns ans Studium – der Patient atmet CO2 ab. Und du hast es auch gesagt: Die Diffusion von CO2 über die alveolo-kapilläre Membran ist nicht so eingeschränkt wie beim Sauerstoff. Das heißt, das sehe ich erst später. Und du hast auch gesagt: Das Problem ist hier wieder diese große Atelektasenbildung, sodass ich so einen großen Totraum habe. Und bei einem schweren ARDS haben teilweise nur noch 20 bis 30 Prozent der Lunge eine normale Ventilation und Perfusion, richtig? Das heißt, mein Ziel ist es jetzt, durch die maschinelle Beatmung wieder mehr Volumen zur Ventilation und Perfusion zur Verfügung zu stellen. Und dafür brauche ich eben aufgrund der Atelektasen einen Überdruck. Ich brauche Druck, um wieder mehr Volumen an diesem Prozess teilhaben zu lassen, weil ich sonst auch im großen Kreislauf eine Hypoxämie habe, was natürlich weitere Folgeschäden hat.
Junge: Ja, genau, das ist korrekt. Man muss sich vielleicht einmal zu den Schweregraden eines ARDS Gedanken machen. Das wird im sogenannten Oxygenierungsindex oder Horowitz-Index bemessen, indem man den Partialdruck des Sauerstoffs im Blut dividiert durch den Sauerstoffanteil, den ich dem Patienten zuführen muss. Also bei Raumluft wäre die FiO2 – “fraction of inspired oxygen” – dann 21 Prozent, also 0,21; und wenn ich jemanden habe, der 100 Prozent Sauerstoff von mir bekommt, dann ist das 1,0. Das bedeutet, wenn jemand einen Partialdruck von 80 mmHg Sauerstoff im Blut hat und ich das durch 0,21 dividiere, ist das ein großer Unterschied im Vergleich zu durch 1,0. Das muss man sich einmal vorführen. Und da muss man vielleicht auch noch einmal sagen: Wie ist denn eigentlich so ein ARDS definiert, damit man nicht nur die Pathophysiologie vor Augen hat, sondern auch einmal weiß, wie man dahinkommt, und das ist ja auch immer ein dynamischer Prozess.
Und die letzte Definition, die wir momentan haben, die hat auch einen Eigennamen, die Berlin-Definition. Da sagt man: “Okay, die Klinik, mit der sich der Patient präsentiert, die Problematik der Respiration, die soll innerhalb einer Woche nach einem Ereignis eingetreten sein oder auf Basis eines bestehenden respiratorischen Problems.” Und da muss ich radiologische Hinweise haben, dass ich beidseits diffuse Infiltrate im Röntgen-Thorax oder im CT-Thorax habe. Und ich kann die Problematik nicht durch reine Pleuraergüsse, Atelektasen oder Raumforderung erklären, sprich, es ist jetzt kein Bronchialkarzinom, das mir die Probleme macht. Und was die Atemmechanik angeht, da muss ein respiratorisches Versagen vorliegen, sprich, die Oxygenierung stellt sich problematisch dar. Und dann sehe ich das im Oxygenierungsindex, dass dieser kleiner 300 mmHg ist, also Quecksilbersäule, und das ist das, womit ich erst mal zu arbeiten anfange.
“Bei einer nicht-invasiven Ventilationstherapie kann sehr viel Aerosolbildung stattfinden.”
AMBOSS: Also, du bist jetzt schon darauf gekommen: Wie erkenne ich denn jetzt das ARDS bei einem COVID-Patienten in unserem Fall? Und ARDS – wir haben es festgestellt – ist wirklich ein komplexes Bild. Was wir uns merken sollen, auch um zu verstehen, wie wir unsere Beatmungsparameter einstellen, ist die Ödembildung, der Surfactant-Mangel, die Atelektasen und eben, dass als Ergebnis nur noch ein Teil der Lunge mit normaler Ventilation und Perfusion zur Verfügung steht. Also, du hast es schon angesprochen. Lass uns jetzt zur praktischen Umsetzung kommen. Wann besteht denn jetzt die Indikation zu intubieren und eine maschinelle Beatmung einzuleiten? Wie stark muss da die Oxygenierungsstörung sein? Das ist wahrscheinlich auch kein strikter Cut-off. Und wir besprechen ja heute den Spezialfall COVID: Versuche ich denn hier vorher noch den Patienten zu "NIV'en" oder noch mit High-Flow an die Situation heranzugehen?
Junge: Die Frage wird natürlich momentan stark diskutiert. Normalerweise, wenn wir einen Patienten hätten, bei dem wir keine große Sorge haben, dass er uns mit großer Wahrscheinlichkeit ansteckt oder wir sehr, sehr viele Probleme parallel haben, mit denen wir jetzt in Zukunft womöglich rechnen müssen, sprich, viele Patienten, die wir behandeln müssen – also, ich mache einmal einen Schlenker zu einem Patienten, der nicht infiziert ist mit diesem Virus: Bei dem würden wir versuchen, über eine sogenannte High-Flow-Sauerstofftherapie – sprich, das ist ein Applikationsweg, da kann ich bis zu 70, 80 Liter fast puren Sauerstoff über eine Nasenkanüle dem Patienten insufflieren und kann ihm darüber eine Erleichterung bringen. Wenn das nicht funktionieren würde, dann würde ich eine nicht-invasive Ventilationstherapie starten. Das bedeutet, der Patient bekommt eine fixierte Maske auf das Gesicht und an diesem Gerät kann ich einen Unterstützungsdruck für den Patienten anlegen. Das heißt, der Patient holt Luft und ich lasse das Beatmungsgerät den Patienten unterstützen. Und auch da kann ich einen sogenannten PEEP wieder einstellen. Das bedeutet, es bleibt mehr Volumen und ein höherer Druck im Thorax zurück. Das würde ich als erste Eskalationsschritte nehmen, bevor ich dann einen Patienten intubiere. Jetzt haben wir bei unseren COVID-19-Patienten die große Gefahr oder die Annahme, dass über die High-Flow-Sauerstofftherapie oder über eine nicht-invasive Ventilationstherapie sehr viel Aerosolbildung stattfinden kann. Und wenn man sich überlegt: “Okay, diese Maske soll eigentlich gut auf dem Gesicht des Patienten fixiert sein.” Im Alltag sieht man ganz häufig, dass wir eine sogenannte Leckage haben, sprich, irgendwo pfeift es nebenher an dieser Maske. Bei den Männern ist es häufig der Bart. Das kann aber auch sein, dass die Gesichtsform einfach nicht optimal ist. Dann habe ich Beatmungsgeräte, die diese Leckage stark kompensieren können. Das sind häufig turbinenbetriebene Geräte und auch die können 70–80 Liter Luft plötzlich bewegen. Und das Ganze pro Minute. Und wenn wir da jetzt ein Aerosol bilden, das in der Luft hängt, dann ist die Wahrscheinlichkeit für uns Therapeuten deutlich größer, dass wir uns infizieren. Und deshalb gibt es momentan auch einen Artikel in der Zeitschrift "Medizinische Klinik – Intensivmedizin und Notfallmedizin", wo uns die führenden Intensivmediziner sagen: "Okay, eher zurückhaltend mit der High-Flow-Sauerstofftherapie und mit der NIV-Therapie." Ich würde die NIV-Therapie nutzen, wenn es darum geht, einen ganz kurzen Moment zu überbrücken, bis ich jemanden intubiere, wenn ich sicher sein kann, okay, ich stehe jetzt auch geschützt, natürlich am Kopf des Patienten, fixiere die Maske mit den eigenen Händen – das ist halt deutlich sicherer, als wenn ich ein Gurtsystem nutze – und kann dadurch sicherstellen: Okay, die Phase ist sehr, sehr kurz und es sind halt keine 24 Stunden am Tag, während denen jetzt die Aerosolbildung stattfindet.
Und jetzt einmal die Überlegung: Okay, bei welchen Patienten kommt denn eigentlich infrage, dass ich sie intubiere? Wir wollen uns das ja nicht so leicht machen und einfach jeden Patienten intubieren. Das hat ja auch Konsequenzen und ist auch einfach immer eine individuelle Entscheidung. Es wird trotzdem immer schwierig bleiben. Wenn wir uns überlegen, dass der Patient natürlich häufig am Anfang von uns eine Nasenbrille bekommt und ich eine Flussrate von 4 bis 5 Liter an dieser Nasenbrille einstelle, dann kann man kalkulieren, dass wir eine FiO2 von 40 Prozent schaffen. Das ist ja schon mal sehr gut. Wenn das nicht reicht, dann wechseln wir meistens zu einer Gesichtsmaske. Da stelle ich vielleicht einen Fluss von 7 bis 8 Litern ein. Durch den relativ dichten Sitz und weniger Nebenluft komme ich da schon auf FiO2-Werte von 60 Prozent. Und wenn das nicht reicht, greift man vielleicht auf eine Gesichtsmaske mit Reservoir zurück. Sprich, da sammelt sich immer noch mehr Sauerstoff, auf den der Patient direkt zurückgreifen kann. Da habe ich mit einer Flussrate von 9 bis 10 Litern womöglich 90 Prozent Sauerstoff. Wenn jemand eine Gesichtsmaske mit Reservoir benötigt, haben die meistens Mindestlaufraten von 6 bis 7 Litern, sprich, er braucht eine FiO2 von 60 bis 70 Prozent. Da kommt es jetzt darauf an: Was für eine Sättigung schafft der Patient damit noch? Wenn die Sättigung damit 95% wäre, würde ich sagen: "Ja, das sieht erstmal safe aus." Und wahrscheinlich könnte man sogar sagen: “Mehr Sauerstoff soll er gar nicht bekommen, weil auch die Hyperoxämie für den Patienten nicht gut ist.”
“Nicht der Tubus ist das Rettende, sondern die Aufrechterhaltung der Oxygenierung.”
Aber wir wollen ja eher über die reden – wo kommen jetzt die Konsequenzen zu tragen? Und wenn ich jemanden habe, der eine Gesichtsmaske mit Reservoir braucht, weil die anderen kleinen Eskalationsschritte, die ich davor hatte, nicht reichen – und ich habe schon 7 bis 8 Liter Fluss, das bedeutet 70 Prozent bis 80 Prozent FiO2 – dann wäre das ein Patient, bei dem ich mich tendenziell dafür entscheiden würde, den zu intubieren, weil das, was wir bisher von den COVID-19-Patienten mit ARDS hören, hat eine große Dynamik, das heißt, das geht sehr schnell. Das ist nicht so, dass wir das so nach 12 bis 24 Stunden häufig ganz in Ruhe reevaluieren können, sondern das sind Stundenbereiche. Und momentan würde ich aus meiner Sicht sagen: Nutzt die Chance, während der Patient noch einigermaßen gut ist und ich mehr Zeit für die Intubation und dadurch weniger Stress habe. Und der Patient braucht jetzt ja schon womöglich 80–90 Prozent FiO2, um auf eine 90er- oder 92er-Sättigung zu kommen. Das heißt, er hustet mir einmal doof und er hat nur noch eine 85er-Sättigung. Das muss man sich mal so plakativ vorstellen. Und ich will den Punkt ja auch nicht verzögern. Nicht der Tubus ist immer das Rettende, sondern die Aufrechterhaltung der Oxygenierung. Aber wenn ich eine gebrauchte Intubation verzögere, schade ich auch dem Patienten. Das heißt, wenn ich eine Gesichtsmaske mit Reservoir mit 7–8 Litern Fluss brauche und der Patient nicht mehr über seine 92er-Sättigung kommt, wäre das für mich eine Indikation, den zu intubieren, damit ich das Setting ruhig habe.
AMBOSS: Ja, das sind wirklich noch mal gute Tipps, gerade auch für Anfänger oder Assistenzärzte, die das eben nicht machen, oder Nicht-Intensivmediziner, Nicht-Anästhesisten, die nicht jeden Tag jemanden intubieren. Das heißt, wir gehen jetzt mal wirklich die konkreten Maßnahmen durch. Ich habe mich jetzt dafür entschieden: Ich möchte meinen COVID-19-Patienten intubieren und maschinell beatmen.
Junge: Genau. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück: Wenn ich das Gefühl habe, ich kriege das auch mit der Gesichtsmaske und Reservoir hin und ich benötige nicht zwingend den Schritt des "NIV'ens", kann ich es verstehen, wenn man sagt: "Ja, ich mache es nicht, weil ich vielleicht auch gar keine Erfahrung damit habe, wie ich dann diesen Schritt mache, ihm die NIV-Maske zu entfernen und dann in die Laryngoskopie einzusteigen."
“Wäre ich unerfahren, würde ich mir denjenigen organisieren, der das am besten kann.”
Und vielleicht auch noch ein, zwei Hinweise, die viele Kollegen bereits schon gegeben haben: Wenn ich jetzt die Intubation durchführen möchte, würde ich mich jetzt auch schon im Haus… Es werden schon die meisten Krankenhäuser, sicherlich auch die Intensivstationen für sich geklärt haben. Ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt jemand wäre, der damit unerfahren ist, den Atemweg zu sichern, dann ist das kein Patient, an dem ich jetzt experimentiere und sage: “Okay, das ist jetzt mein Patient, jetzt gucken wir, was klappt.” Dann würde ich mir einfach denjenigen im Haus organisieren, der das am besten kann. Das kann im Tagesgeschäft der erfahrene Facharzt aus der Inneren sein. Das kann im Nachtdienst der Anästhesist sein. Da muss ich mir aber vorher die Strukturen vor Augen führen, damit ich, wenn ich das Gefühl habe, es muss ein bisschen schneller gehen, weiß, wen ich anrufen kann und muss. Und ich bereite trotzdem alles schon mal so vor, wie der klinikinterne Standard es vorsieht. Und dann kann ich das im Team lösen.
Und es soll auch nicht so sein, dass wir bei diesen Patienten mit zu vielen Zuschauern im Raum stehen. So nach dem Motto: “Okay, wie läuft das eigentlich bei dem?”, und alle stehen mit Maske daneben, sondern nur diejenigen, die wirklich gebraucht werden, damit sich so wenige wie möglich der Gefahr aussetzen. Das muss man sich hier noch mal vor Augen führen.
Und ein, zwei Hinweise wurden uns da auch schon gegeben. Also, wenn ich die NIV-Maske jetzt auf dem Patienten fixiere, die Narkose eingeleitet wurde, dann kommt der Moment, wenn ich laryngoskopieren will und ich die NIV-Maske beiseite packe. Normalerweise kannst du die relativ locker beiseite packen; das Beatmungsgerät stellt irgendjemand, den man darum bittet, nebenher auf Standby. Hier würde ich es so machen: Ich halte die Maske nach Einleitung der Narkose so lange drauf, bis auch tatsächlich das Beatmungsgerät ausgestellt ist, weil es womöglich in eine Apnoe-Ventilation gerät. Das bedeutet, das Beatmungsgerät erkennt: "Oh Mensch, mein Patient holt keine Luft mehr. Da habe ich doch was hinterlegt. Ich soll jetzt selber atmen." Und jetzt pustet es mir die gesamte Luft aus der Maske mit dem Sputum zusammen in den Raum. Das wäre kontraproduktiv. Also: Erst Standby einschalten lassen, dann in Ruhe die Maske beiseitelegen, dann eine Laryngoskopie, optimalerweise mit Videolaryngoskop, weil ich mich dann nicht so nah an den Patienten heranbewegen muss. Ich kann auf einen Bildschirm schauen und über die indirekte Laryngoskopie den Patienten intubieren und einen größeren Abstand halten. Wichtig ist für alle, die wenig die Videolaryngoskopie nutzen: Der Tubus muss anders vorbereitet sein. Der Tubus braucht eine Hockeyschläger-Form. Die Spitze muss mehr betont sein, weil ich ja eben nicht den direkten visuellen Weg nutzen kann. Man kommt sonst – plakativ gesagt – häufig nicht um die Kurve. Man muss ihn sich mehr vorbiegen und sich so ein bisschen vorstellen, dass das wie ein Hockeyschläger aussieht. Und dann kann ich deutlich besser intubieren.
Und es gab auch schon die Hinweise, dass ich den Patienten nach der Intubation möglichst nicht auskultieren soll. Also, es wird immer die Kapnometrie und Kapnografie genutzt, um die sichere Tubuslage zu verifizieren. Die Auskultation nutzen wir nur, um zu sagen: Der Patient ist seitengleich belüftet. Das ist nicht für die sichere Tubuslage in der Trachea gedacht. Aber auch da gibt es Hinweise, dass man sagt: “Ja, nutz’ das Stethoskop nicht, weil du einfach sehr nah an den Patienten herangehst”, das muss man bedenken. Diese Risikoabwägung muss jeder für sich selber machen.
”Bei einem Tidalvolumen von mehr als 6 mL pro Kilogramm Körpergewicht verschlechtert sich die Überlebenswahrscheinlichkeit.”
Und jetzt habe ich diesen Patienten – das kann sein, dass ich ihn gerade intubiert habe oder ich derjenige bin, der eine Schichtübergabe hatte und jetzt an dem Beatmungsgerät ankommt. Ich gehe mal davon aus, ich habe diesen Patienten gerade intubiert. Dann haben wir schon gesagt, er braucht einen hohen Sauerstoffanteil, damit er mit einer Gesichtsmaske mit Reservoir überhaupt seine Oxygenierung aufrechterhält. Da waren wir schon irgendwie bei 80 Prozent FiO2. Und es gibt einige Punkte, die beim ARDS evidenzbasiert sind, wie ich diesen Patienten therapieren soll. Gehen wir jetzt erst mal darauf ein. Der Patient oder die Patientin soll als Tidalvolumen – das ist das Beatmungsvolumen, das ich einstelle oder generiere über meine druckkontrollierte Beatmung, auf die ich gleich zu sprechen komme – 6 mL pro Kilogramm Körpergewicht bekommen. Und dabei ist das Idealgewicht gemeint und es gibt einen Unterschied für Männer und für Frauen. Das ARDS-Netzwerk hat da eine Formel zur Verfügung gestellt, wie ich das ausrechnen kann. Bei AMBOSS sind mittlerweile auch schon für Männer und für Frauen unterschiedliche Tidalvolumina hinterlegt. Als Beispiel: Ein Mann mit einer Körpergröße von 1,60 m hätte ein Tidalvolumen von 340 mL und eine Frau von 315 mL. Und es ist evidenzbasiert, dass, wenn ich über diese 6 mL pro Kilogramm Körpergewicht gehe, die Überlebenswahrscheinlichkeit von meinen Patienten schlechter wird. Und das hat damit zu tun, dass, wenn ich eine Beatmung anlege, das jedes Mal in kleinen Punkten ein Stress für die Lunge ist, und Stress bedeutet jedes Mal eine Entzündungsreaktion. Das heißt, ich öffne eine Alveole und sie fällt womöglich wieder zusammen. Ich habe eine offene Alveole und neben der offenen Alveole ist eine atelektatische Alveole. Und jetzt überdehne ich womöglich die offene Alveole und die atelektatische öffne ich gar nicht, weil mein Tidalvolumen sehr hoch ist. Und das bedeutet jedes Mal Stress, jedes Mal Wandspannung. Das erhöht die Entzündungsreaktion und deshalb macht es die Überlebenswahrscheinlichkeit schlechter. Also, das heißt, das Tidalvolumen ist das Allererste, was ich für mich fest definiere. Und ich weiche von diesem Tidalvolumen erst ab, wenn ich gar keine andere Möglichkeit mehr habe, diesen Patienten kurzfristig am Leben zu halten.
Das nächste, was wir auch wissen, ist: Der Inspirationsdruck – das ist das, was ich benötige, um das Tidalvolumen zu generieren – abgezogen vom PEEP soll kleiner gleich 15 Millibar sein; also sprich, ich habe einen 25 Millibar Inspirationsdruck minus 10 Millibar PEEP. Das ist der sogenannte Driving Pressure oder einfach Druckdifferenz.
Dann soll ich insgesamt mit meinem Inspirationsdruck unter 30 Millibar bleiben, denn, wenn ich darüber komme, wird auch der Stress höher und die Überlebenswahrscheinlichkeit geringer. Also, der Wert variiert so ein bisschen zwischen 30 und 35 und wird sicherlich auch davon abhängig sein, ob ich eher einen hochadipösen Patienten oder einen kachektischen Patienten habe. Das sind ja nun auch andere Voraussetzungen.
Und ich soll versuchen, meinen FiO2 kleiner als 60 Prozent hinzukriegen, damit ich in lokalen Punkten keine Hyperoxämie habe. Das heißt, das eine ist ja in der Lunge und das, was im Blut ankommt, ist ja nochmal etwas anderes.
Und der PEEP, das sagt uns das ARDS-Netzwerk und auch die S3-Leitlinie, da soll ich eher einen hohen PEEP wählen. “Und was bedeutet jetzt erstmal hoch?”, fragt man sich. Wenn man normalerweise eher so mit COPD-Patienten zu tun hat, dann kommt man mit fünf bis sechs schon sehr gut zurecht. Die brauchen halt gar keinen PEEP. Wenn ich Patienten habe, die mal ein bisschen Pneumonie haben und ein bisschen beatmet werden, dann ist man schon bei acht und denkt: “Das ist ja auch schon ein bisschen höher.” Jetzt haben wir zwei Tabellen, auf die wir zurückgreifen können, um erst mal einen Eindruck zu haben: Was bedeutet ein höherer PEEP? Es gibt einmal die "Lower PEEP / higher FiO2"-Tabelle und dann gibt es die "Higher PEEP / lower FiO2"-Tabelle. Das sind zwei Tabellen, die auch vom ARDS-Netzwerk vorgeschlagen werden. Die Intensivmediziner, die Kollegen, empfehlen in ihrem Artikel, dass wir auf die "Higher PEEP / lower FiO2"-Tabelle zurückgreifen.
“Der PEEP soll die Lunge auffalten – wie wir ein nasses Küchenhandtuch ausbreiten würden, bevor wir es zum Trocknen auf die Heizung legen.”
Einmal zur Überlegung: Was soll der PEEP jetzt eigentlich in der Lunge bewirken? Es ist einmal so, dass wir dieses Ödem in der Alveole haben; da ist Wasser in der Alveole. Dieses Wasser wollen wir da raus haben, das wollen wir rauspressen. Das machen wir mit dem PEEP, mit dem kontinuierlichen Druck, der da drin bleibt. Der wird angelegt und das Wasser wird wieder ins Interstitium zurückgedrückt und wird auch vom Blut über die Kapillare wieder wegtransportiert. Dafür brauche ich einen Druck. Und ich erweitere zusätzlich die Oberfläche der Alveole, wenn ich den PEEP etwas höher wähle, denn wenn mehr Druck im Thorax zurückbleibt, ist die Alveole ein bisschen größer. Man kann sich vorstellen, wenn die Alveole eine größere Oberfläche hat, dann kann an einer größeren Oberfläche auch deutlich mehr Gasaustausch stattfinden. Ganz einfach vorgestellt: Ich nehme ein Küchenhandtuch, das mache ich nass und ich falte es dreimal, packe das auf die Heizung, vergleiche das mit dem anderen Küchenhandtuch, das die gleiche Größe hat, das ich genau so nass mache, aber ausgebreitet auf die Heizung lege. Das eine ist ruckzuck trocken, nämlich das Ausgebreitete, und das andere ist immer noch feucht, wenn ich am nächsten Morgen in die Küche komme, weil die Oberfläche eine ganz andere ist. Und das soll einmal der PEEP machen, sprich das Ödem verdrängen, die Oberfläche der Alveole erweitern. Und dann wird es so sein, dass ich durch das Tidalvolumen Alveolen öffne, die vorher atelektatisch waren. Und ich möchte mit meinem PEEP verhindern, dass an dieser Stelle jetzt wieder eine Atelektase passiert. Also die erneute Atelektasenbildung, das Derecruitment, das wollen wir mit einem höheren PEEP verhindern.
Und die Lunge, das hatten wir schon besprochen, die ist jetzt schwer und die ist feucht – und deshalb brauche ich einfach einen höheren Wert. Und wenn ich reinschaue, um mich mal zu orientieren, in die "Higher PEEP"-Tabelle, die auch bei AMBOSS hinterlegt sein wird, dann sehe ich, dass bei einem FiO2 von 0,5 bis 0,8 dann ein PEEP von 18 steht. Wenn ich als Anwender, der selten mit ARDS-Patienten zu tun hat und weniger auch mit Beatmung zu tun hat, den PEEP von 18 lesen würde, dann wird sich wahrscheinlich so ein gewisses ungutes Gefühl breit machen. Ist das wirklich richtig? Und die Frage ist halt: Fange ich sofort mit 18 an oder gebe ich mir halt mit dem Patienten eine gewisse Zeit, bis ich mich entscheide, die Beatmung zu eskalieren, wie es die "Higher PEEP / lower FiO2"-Tabelle vorsieht? Und ich würde es ganz einfach machen: Wenn ich einen Patienten habe, den ich intubieren musste, dann fange ich mit einem PEEP von 14 an. Dann bleibe ich zwar unter dem, was die "Higher PEEP"-Tabelle vorsieht, aber ich bin auf alle Fälle in dem Bereich, in dem ich mich bewegen werden muss. Man kann sagen, ein ARDS-Patient mit einem PEEP unter 10 hat entweder kein ARDS und die Beatmung ist komplett falsch eingestellt; oder ich befinde mich am Ende der ARDS-Therapie, sprich, der Patient wird deutlich besser und ich kann meine Beatmung schon wieder deeskalieren. Und wenn ich jetzt erst mal einen PEEP von 14 einstelle, dann beobachte ich in dem Moment natürlich die Hämodynamik. Wir hatten vorher ja besprochen, der venöse Rückstrom zum Herzen wird geringer. Und ich kann auch sagen: Ja, ich trau mich eben nicht sofort einen PEEP von 14 anzulegen. Dann fängst du mit einem PEEP von 12 an, aber wir fangen eben nicht mit einem PEEP von 8 an. Und ich kann es auch verstehen, wenn man sagt: "Hey, ich trau mich nicht, einen PEEP von 18 von Anfang an einzustellen." Aber wir werden uns bei einem PEEP von 14 bewegen müssen. Das ist die allererste Vorstellung, die ich für mich haben muss.
“Wenn ich CO2 aus dem Blut loswerden muss, steuere ich das mit der Beatmungsfrequenz.”
Und das, was ich mir als oberstes Dogma erst mal definiere, ist das Tidalvolumen des Patienten. Da gucke ich in die Tabelle und bin auch ganz ehrlich: Ich berechne es auch nicht jedes Mal. Ich habe eine Tabelle dabei, da gucke ich drauf und da sehe ich: “Aha, der Mann ist 1,70 Meter groß. Das bedeutet, er bekommt von mir ein Tidalvolumen von 400 mL.” Dann stelle ich einen PEEP ein. Wir nehmen jetzt mal die 14, weil wir gesagt haben: "Gut, er hat halt 60–70 Prozent FiO2 benötigt." Und wir müssen überlegen: “Okay, jetzt habe ich ein Tidalvolumen definiert. Ich habe definiert, was für einen PEEP ich einstelle. Jetzt brauche ich noch eine Beatmungsfrequenz.” Das heißt: Wie häufig soll er eigentlich Luft von mir bekommen? Und wir werden davon ausgehen müssen, dass die Patienten erst mal ungefähr eine Beatmungsfrequenz von 16 bis 18 benötigen, dass wir uns da mal einpendeln. Wenn ich vorweg jemanden habe, der schon eine Decarboxylierungsstörung hat – sprich, er hat ein hohes CO2 im Blut – da kann ich auch gleich mit 18–20 anfangen. Wenn sie keine Decarboxylierungsstörung haben, dann fange ich erst mal mit 16–18 an.
AMBOSS: Ja, sag noch mal ganz kurz: warum? Weil er zu viel CO2 im Blut hat und das abgeatmet werden muss, richtig?
Junge: Genau. Also, das CO2 diffundiert in der Alveole eigentlich sehr schnell aus dem Blut in die Luft und die Konzentration gleicht sich sehr schnell an. Und der weitere Gasaustausch ist davon abhängig, dass wir in der Alveole immer wieder eine geringe Konzentration an Kohlendioxid haben. In der Raumluft ist ja fast gar kein Kohlendioxid. Und durch das Atmen schaffen wir quasi diesen Diffusionsgradienten. Wenn in der Alveole selber die gleiche Konzentration an CO2 wie im Blut ist, dann gibt es keinen Grund mehr für die Diffusion. Deshalb ist es so, dass wir die Decarboxylierung durch Atemminutenvolumen schaffen. Das ist so ein Statement, das kann man sich auch einbrennen. Also, wenn ich CO2 aus dem Blut loswerden muss, dann schaffe ich das durch viel Atemfrequenz oder Beatmungsfrequenz, das steuere ich mit der Beatmungsfrequenz.
Und da, denke ich, ist ein pragmatischer Ansatz zu sagen, ich fange mal bei 16–18 an. Also, 12 – das ist das, wie ich in Ruhe Luft hole – das macht gar keinen Sinn, weil jemand, der eine kranke Lunge hat und jetzt ein kleines Tidalvolumen bekommen soll, der kann nicht bei 12 oder bei 10 landen, dann stimmt auch irgendwas nicht. Und irgendwo nach oben sind uns auch Grenzen gesetzt. Es kann sein, dass wir hohe Beatmungsfrequenzen brauchen werden, um das CO2 loszuwerden. Es kann 24 oder 26 werden, aber irgendwann kommen wir an die Grenze, wo der Patient einfach gar nicht... Dadurch, dass die Beatmung ein passiver Vorgang ist, kommt die Luft gar nicht mehr raus. Das müssen wir auch bedenken. Das heißt, wir können nicht 45er Beatmungsfrequenzen einstellen. Das wird bei unseren erwachsenen Patienten irgendwann nicht mehr funktionieren. Also kalkulieren wir eine Beatmungsfrequenz von 16 bis 18.
“Der Luftballon soll nie wieder so viel Luft verlieren, dass es schwer wird, ihn aufzupusten.”
Und jetzt muss ich mir auch überlegen: Das Tidalvolumen habe ich zwar definiert, aber wie kriege ich das denn da rein? Und ich habe die meiste Erfahrung mit der sogenannten druckkontrollierten Überwachung. Das heißt, ich sage dem Gerät: “Du sollst das Druckniveau anlegen und das Druckniveau bleibt angelegt, sagen wir mal, von 25 Millibar für 1,8 Sekunden.” Das definiere ich an dem Gerät. Und dann ergibt sich danach erst das Tidalvolumen, wie viel da überhaupt reingekommen ist. Habe ich einen PEEP von 14 und meinetwegen einen Inspirationsdruck von 25 angelegt, dann ist die sogenannte Driving Pressure – wir erinnern uns, die Druckdifferenz – 11 und eine ganz, ganz gesunde Lunge hat plötzlich ein sehr hohes Tidalvolumen und eine sehr kranke Lunge und ein sehr übergewichtiger Patient kommt dann auf ein sehr kleines Tidalvolumen. Das muss ich mir erstmal angucken. Das heißt also tatsächlich Ausprobieren.
Ich habe mich also für die Beatmungsfrequenz entschieden. Ich muss mir überlegen: “Was für eine Inspirationszeit lege ich bei diesem Patienten eigentlich an?” Ich würde mit 1,5 Sekunden anfangen und – nach der Frequenz, nach der Inspirationszeit – jetzt den Inspirationsdruck einstellen. Den PEEP habe ich ja schon eingestellt. Und wenn ich jetzt 25 einstelle, dann sehe ich: Welches Tidalvolumen kommt dabei raus? Ich habe gesagt, mein männlicher Patient ist 1,70 Meter groß und 400 mL will ich erreichen. Wenn ich sehe: Okay, bei einem Inspirationsdruck von 25 komme ich nur auf ein Tidalvolumen von 370 mL, dann stelle ich um ein Millibar hoch. Dann bin ich bei 26 Millibar Inspirationsdruck und gucke, ob ich dann vielleicht die 400 mL erreiche.
AMBOSS: Du veränderst den Inspirationsdruck, nicht den PEEP.
Junge: Genau. Ich lasse erst mal den PEEP statisch stehen, weil der Inspirationsdruck das Entscheidende ist. Und ich habe ja einen Bereich: Ich will bei meinem Patienten mit dem Inspirationsdruck nicht über 30 Millibar kommen und ich möchte die Druckdifferenz nicht über 15 haben. Und ich habe mir erst mal über die PEEP-Tabelle einen hohen PEEP definiert und gucke mir jetzt an, ob ich das mit den Vorgaben erst mal einstellen kann.
AMBOSS: Okay. Und wir waren gerade bei dem Punkt, dass mein 1,70 Meter großer Mann nicht auf sein Tidalvolumen von 400 mL kommt und du jetzt dementsprechend den Inspirationsdruck um ein Millibar erhöhst.
Junge: Genau, das ist richtig. Du kannst den Inspirationsdruck auch um 2 Millibar oder um 3 anheben, wenn der Abstand zu dem Tidalvolumen, das du erreichen willst, einfach sehr groß ist. Also, wenn du siehst: Er kommt jetzt gerade auf 260 mL Tidalvolumen, dann stell es halt um 3 oder 4 Punkte hoch. Wir haben ja ein bisschen Luft gehabt. Und wenn ich sehe, ich bin jetzt schon bei einer Druckdifferenz von 17, da muss ich mir Gedanken machen, woran das liegt. Dann kann ich gucken, ob ich eventuell den PEEP um 2 Punkte reduziere oder wieder um 2 Punkte über die 14 Millibar erhöhe, um zu schauen, ob in irgendeinem Bereich die Compliance des Thorax und der Lunge dort besser ist. Wir hatten ja am Anfang über diesen unteren Inflektionspunkt gesprochen, die richtige Vordehnung des Thorax und der Lunge. Also, der Luftballon soll nie wieder so viel Luft verlieren, dass es schwer wird, ihn aufzupusten. Damit kann ich dann auch so ein bisschen spielen. Da muss ich gucken, dass ich optimalerweise kleiner 15 Millibar bleibe. Es gibt da tatsächlich unterschiedliche Varianten. Wie ich das finde, das ist, glaube ich, zu komplex für einen Podcast.
Für denjenigen, der damit bisher keine Erfahrung hat, würde ich sagen: Fang mit einem PEEP von 14 an. Hast du jemanden mit einer sehr stark eingeschränkten Hämodynamik, weil auch ein septisches Krankheitsbild mit septischem Schock dabei ist, dann würde ich eher einen kleineren PEEP wählen. Guck, ob du mit einem 12er-PEEP eventuell schon die Oxygenierung deutlich verbessern kannst. Wenn ich jemanden habe, der eher adipös ist, dann würde ich eher bei 14–16 beim PEEP landen. Aber das ist auch mehr so ein Anwenderhinweis. Das ist jetzt nicht etwas, wo man sagt: Okay, da kann ich dir 25 Paper für vorlegen. Das ist ganz klar. Da bewegt sich die Wissenschaft immer in dem Bereich: Ja, wie passen wir die Erkenntnisse eigentlich gerade an?
”Jeder Beatmungshub ist Stress für die Lunge, und wir haben ja nun mal eine sehr kranke Lunge – wir wollen nicht die Normwerte einer Blutgasanalyse erreichen.”
Und es gibt auch Ziele, die ich bei meinem ARDS-Patienten erst mal erreichen will. Wir wollen nicht die Normwerte erreichen, die wir normalerweise in der Blutgasanalyse kennen. Wir sagen ganz bewusst: “Ich gebe mich bei diesem Patienten auch mit weniger zufrieden. Ich versuche, über den PEEP und über die FiO2-Einstellung irgendwie einen Sauerstoffpartialdruck zwischen 60–80 mmHg hinzubekommen. Das soll eine Sättigung von 90 bis 94 Prozent in der Blutgasanalyse sein. Und ich versuche, über meine Beatmungsfrequenz ungefähr einen CO2-Partialdruck kleiner 70 mmHg hinzubekommen. Das bedeutet, wenn man rein die respiratorische Seite betrachtet, soll der pH-Wert möglichst größer 7,2 sein.
Die Grenzen sind so gesetzt, weil man sagt: Jeder Beatmungshub ist Stress für die Lunge, unterhält eine Entzündungsreaktion; und wir haben ja nun mal eine sehr kranke Lunge, wir wollen damit gar nicht physiologische Werte erreichen. Und erst, wenn mir zum Beispiel der pH-Wert aus den Fingern gleitet und ich einen pH von 7,1 habe – das macht sich in der Hämodynamik dann ja auch bemerkbar, weil mein Noradrenalin bei so einem sauren Milieu gar keine Vasokonstriktion mehr machen kann – dann muss ich mir halt überlegen: Wie weiche ich davon ab, was sind meine anderen Möglichkeiten? Und genauso ist es halt auch bei der Oxygenierung. Ich will keine Hyperoxämie haben, weil auch das mit den freien Radikalen wieder zu Zellschäden führt.
“Einen Patienten, bei dem permanent Schleim im Tubus steht, muss ich erst mal absaugen.”
AMBOSS: Ja, was mache ich denn jetzt? Sagen wir mal, ich habe eben diese Schritte angefangen, die du gesagt hast, habe gesehen: Okay, mein Tidalvolumen ist anfangs noch ein bisschen zu niedrig, habe ein bisschen den Inspirationsdruck erhöht, ein bisschen da gespielt, sehe plötzlich – du hast es gesagt – der Punkt ist überwunden, die Compliance der Lunge ist jetzt gut. Ich habe ein Tidalvolumen, was meiner Tabelle entspricht. So, jetzt bin ich erst mal zufrieden, stelle aber dann nach 30 Minuten fest: Das Oxygenierungsziel ist leider verfehlt. Der Partialdruck des O2 in meiner Blutgasanalyse sinkt. Wo drehe ich jetzt erst mal?
Junge: Also, gehen wir mal davon aus, du stellst deinen FiO2, deinen Sauerstoff, so ein, dass du sagst: “Okay, ich muss irgendwie auf einen Sauerstoffpartialdruck von 60 bis 80 kommen.” So, und wenn du jetzt feststellst: “Ich muss einen sehr hohen FiO2-Wert einstellen”, kommt der Oxygenierungsindex wieder zum Tragen. Bei den meisten BGA-Geräten kannst du gleich einstellen, was für eine FiO2 du bei der Beatmung eingestellt hast. Dann berechnet dir das Gerät automatisch, was der Oxygenierungsindex ist. Für denjenigen, der es nicht eingestellt hat oder bei dem das Gerät das nicht kann, nochmal: Ich nehme mir den Sauerstoffpartialdruck im Blut, sagen wir mal 80, und dividiere das durch die FiO2, zum Beispiel 0,8, das macht die Sache hier ganz einfach, das wäre dann 100. Das heißt, der Oxygenierungsindex wäre dann 100.
Ich muss ein, zwei Probleme noch ausgeschlossen haben, bevor ich dahin komme. Also, ich habe einen Patienten, der ein ARDS hat. Ich kann ausschließen, dass er einseitig intubiert ist. Ich kann ausschließen, dass er große Pleuraergüsse hat, die ich womöglich durch Drainage entlasten kann. Und ich gehe davon aus, dass er keine Atelektasen durch Schleimverlegungen hat. Also einen Patienten, bei dem permanent Schleim im Tubus steht, muss ich erst mal absaugen und womöglich dann auch bronchoskopieren. Wir wollen keine pauschale Bronchoskopie bei den COVID-19-Patienten machen, weil auch das ein gewisses Ansteckungsrisiko birgt. Also, wenn das trocken ist, dann brauche ich nicht bronchoskopieren. Kommt mir aber permanent Schleim entgegen, sollte ich einmal bronchoskopieren, damit ich sicher bin, dass nicht irgendwo ein Lungenlappen durch Schleim verlegt ist.
Wenn ich das alles ausgeschlossen habe, dann schaue ich mir weiterhin den Oxygenierungsindex an. Ich glaube, 30 Minuten nach der Intubation wäre sehr sportlich. Man muss dem schon eine Stunde locker Zeit geben oder auch anderthalb Stunden, es sei denn, ich sehe, ich kann die Oxygenierung gar nicht aufrechterhalten. Also, gehen wir davon aus, ich habe jetzt anderthalb Stunden abgewartet. Ich habe einen guten PEEP von 14 eingestellt, ich schaffe das Tidalvolumen, und es wird einfach mit dem Oxygenierungsindex nicht besser. Ich bin bei kleiner 150. Und das ist die entscheidende Größenordnung, die wir jetzt im Kopf haben müssen. Sprich: Sauerstoffpartialdruck durch FiO2 ist kleiner 150. Dann kommt eine evidenzbasierte Maßnahme zum Tragen: Ich muss den Patienten in die Bauchlagerung bringen. Obwohl er intubiert beatmet ist, soll er in Bauchlage kommen.
”Wenn ich den Patienten auf den Bauch drehe, folgt die Luft dem Weg des geringsten Widerstands und die Atelektasen öffnen sich.”
Und das hat folgenden Grund: Wir haben im dorsalen Bereich eine viel größere Oberfläche an Alveolen, die am Gasaustausch teilnehmen können. Der Patient, der auf dem Rücken liegt, dessen schwere Lunge jetzt feucht ist, lastet aber auf dem dorsalen Bereich und dort haben sich überall Atelektasen, Mikroatelektasen gebildet. Und wir haben es nun mal so: Bei der Überdruckbeatmung folgt die Luft, die wir mit Überdruck in den Thorax bringen, immer dem Weg des geringsten Widerstandes und der ist nach oben. Das heißt, der Thorax weitet sich und die Luft geht eher Richtung ventral, aber nicht dahin, wo wir sehr viele Alveolen haben, nämlich im dorsalen Bereich. Jetzt wird natürlich ein gewisser Teil dorsal weiterhin perfundiert. Das heißt, wir haben ein Shuntvolumen. Blut kommt in den Bereich, wo keine Ventilation stattfindet, kann nicht oxygeniert werden – und das müssen wir jetzt irgendwie verändern. Und wenn ich den Patienten auf den Bauch drehe, dann folgt weiterhin die Luft dem Weg des geringsten Widerstandes und plötzlich ist das nach dorsal, also der Rücken liegt aber Richtung deckenwärts, und dort öffnen sich jetzt die feinen Atelektasen, die sich gebildet haben und wir sehen eine deutliche Verbesserung der Oxygenierung. Und wenn sich dort die Atelektasen zusätzlich öffnen, dann wird auch dort die Perfusion noch besser. Und wir sehen: Okay, das Gewicht lastet jetzt ein Stück weit auf den ventralen Anteilen und verlagert sich so ein bisschen innerhalb der Lunge. Aber wir öffnen die Atelektasen. Das ist kein aktiver Vorgang im Sinne eines Recruitment-Manövers, was man sonst so kennt, beim Lachmann-Manöver, was einem im Hinterkopf ist. Das ist etwas, das einfach dadurch passiert, dass wir eine gute Beatmung eingestellt und den Patienten gedreht haben. Wir müssen keine exorbitant hohen Beatmungsdrücke einstellen, um zu sagen: “Jetzt öffne ich mal die Lunge”, sondern wir rekrutieren die Lunge peu à peu.
”Der Patient muss mindestens 16 Stunden auf dem Bauch liegen.”
AMBOSS: Wunderbar. Wie lange gebe ich dem Zeit?
Junge: Du meinst, wenn ich jemanden auf den Bauch gedreht habe? Also, wir müssen dazu noch ein paar Punkte bedenken. Wir sprechen von der kompletten Bauchlage, wenn wir jemanden wirklich um 180 Grad drehen. Wir sprechen von einer inkompletten Bauchlage, wenn wir jemanden um 135 Grad drehen. Die 180 Grad sind deutlich besser für die Verbesserung der Oxygenierung als 135 Grad. Aber es gibt manchmal Gründe, warum man jemanden vielleicht einfach gar nicht weiter drehen kann. Es können irgendwelche Verletzungen sein, die in der Vorgeschichte bestanden haben, oder irgendwelche Drainagen. Bei unseren COVID-Patienten wird das weniger wahrscheinlich sein, also: um 180 Grad drehen. Der Patient muss eine gewisse Mindestzeit auf dem Bauch liegen und das sind 16 Stunden. Der Patient wird einmal gedreht und dann bleibt er 16 Stunden auf dem Bauch liegen. Dann wird er wieder zurück gedreht, weil das Hauptproblem, das dieser Patient natürlich haben kann, ist ein Ulkus im Gesicht oder Druckstellen im Bereich des Auges zu entwickeln.
AMBOSS: Oder auch Lagerungsschäden des Plexus brachialis.
Junge: Genau, da sind die Kollegen der Pflege wieder unsere Spezialisten, die ein Auge darauf haben, diese Bereiche freizuhalten. Und wie mit allen Maßnahmen müssen wir auch da die ganz enge Kommunikation mit den Kollegen der Pflege pflegen, denn die haben ja häufig eine längere Erfahrung als die junge Anwenderin, der junge Anwender auf der Intensivstation und es macht immer Sinn, einmal zu besprechen: “Okay, was denkt ihr? Fangen wir jetzt mit der Bauchlage an? Was braucht man zur Vorbereitung?” Wir werden demnächst eine Checkliste dafür zur Verfügung stellen, dass wir das einmal ganz in Ruhe durchgehen können.
Und jetzt einmal so: Also, der Patient liegt auf dem Bauch. 16 Stunden soll er da liegen bleiben, dann kommt er zur Entlastung der Haut 4 Stunden auf den Rücken und er geht automatisch nach der ersten Lage wieder zurück. Das kann sein, dass wir nach einem Mal Drehen sagen: "Meine Güte, die Lunge ist ja jetzt so gesund geworden. Alles schick, wir lassen ihn so." Die Wahrscheinlichkeit ist furchtbar gering. Man muss damit rechnen, dass der Patient mindestens dreimal auf den Bauch muss. Das ist eher wieder so ein Anwenderhinweis, sage ich jetzt mal. Das kann auch gut sein, dass wir das sieben- oder achtmal hintereinander machen müssen. Aber nach einem Mal wird es meistens nicht besser.
Was man häufig sieht, ist: Es wird deutlich besser in Bauchlage. Man dreht diesen Patienten nach 16 Stunden zurück auf den Rücken und sieht erst mal, es bleibt gut, toll, und bleibt auch nach 4 Stunden weiterhin gut, toll. Meine Schicht ist beendet und ich sage, komm, lass ihn auf dem Rücken liegen, es ist ja deutlich besser geworden. Und der nächste Kollege oder Kollegin in der nächsten Schicht sieht: Die Oxygenierung wird jetzt peu à peu immer wieder schlechter. Es liegt einfach daran: Die Lunge ist weiterhin feucht. Der Druck der Lunge lastet weiterhin auf dem dorsalen Bereich. Die Atelektasen bilden sich peu à peu wieder und wir sehen, dass es wieder schlechter wird. Dann fange ich wieder mit der Bauchlage an, habe aber den Zeitraum deutlich verzögert. Das heißt, ich muss damit rechnen, dass ich ihn häufiger drehen muss.
Und wichtig wäre auch, wie mit den meisten Entscheidungen: Ich muss sie irgendwann treffen und zwar für die erste Bauchlage. Wir müssen uns relativ zügig dazu entscheiden, das heißt nicht innerhalb von 5 Minuten, aber wir sollen da schon relativ schnell machen. Also, wenn in meiner Schicht ein Patient dann eine Oxygenierungsstörung hat und der Oxygenierungsindex kleiner 150 bleibt, dann muss ich mich in dieser Schicht dazu entscheiden. Das ist nichts, was ich drei Visiten später mache, sondern ich muss die Entscheidung treffen. Dann muss ich ihn auf den Bauch drehen. Dann lasse ich ihn oder sie 16 Stunden da liegen und muss damit rechnen, dass ich das mehrmals mache. Und ich höre erst mit dieser Bauchlagentherapie auf, wenn die Oxygenierung in Bauchlage genauso gut ist wie in Rückenlage und ich mit der FiO2 definitiv unter 0,6 bleiben kann.
AMBOSS: Und für wie lange? Du hast es ja gesagt: Vielleicht denke ich erst mal, es ist schön, aber dann wird es doch wieder schlechter. Wie lange muss das so sein, dass ich sage: Das war meine letzte Runde, jetzt bleibt er in Rückenlage?
Junge: So, jetzt ist natürlich die Frage: Ja, wie soll ich das nach 4 Stunden entscheiden? Das heißt, die ersten drei Mal würde ich mir diese Frage gar nicht stellen, da bin ich ganz ehrlich. Es sei denn, ich lande plötzlich bei einer FiO2 von 0,3 oder so. Das ist jetzt einfach mal gesponnen, wenn ich bei 0,3 lande und sehe: Okay, das ist ja viel besser geworden und da verändert sich gar nichts in Rückenlage und dann kann das auch mal ganz spontan sein. Bei einer sehr jungen, gesunden Lunge, die einfach nur einmal den PEEP brauchte, für 16 Stunden in Bauchlage dazu, kann das sein. Da muss ich dann natürlich ein bisschen individuell entscheiden. Die meisten Lungen werden das nicht hergeben, die müssen dreimal gedreht werden. Und dann gucke ich nach der dritten Runde: Ich bin bei einem FiO2 von 40 Prozent. Und ich sehe: Das hält sich stabil. Dann warte ich noch einfach mal 5, 6 Stunden ab. Und wenn sich das weiter auf dem Rücken stabil hält, dann bleibe ich da einfach mal, dann kann ich das machen. Ich würde bei den ersten beiden Malen auf gar keinen Fall damit rechnen.
“Rechtzeitig mit den Kollegen des ECMO-Zentrums Kontakt aufnehmen!”
AMBOSS: Und es ist ja jetzt das schöne Szenario, also die Variante 1. Es hat sich in der Tat verbessert, die Oxygenierungsstörung hat sich behoben. Es gibt durch die Bauchlage keine so gravierende Oxygenierungsstörung mehr. Aber jetzt haben wir natürlich auch noch das andere Szenario, dass es nicht besser, sondern eventuell sogar schlechter wird. Richtig?
Junge: Ja, genau. Es kann sein, dass es gar nicht besser wird oder schlechter wird. Wenn es schlechter wird, muss man sich Gedanken machen: Warum wird das eigentlich gerade schlechter, obwohl es in dieser Situation besser werden sollte? Da kann es sein, dass sich Schleim mobilisiert hat und mir jetzt womöglich irgendwo einen Hauptbronchus verlegt. Das muss man einmal bedenken, dass man bei Schleimmobilisation vielleicht absaugt oder eine Bronchoskopie durchführen muss.
Ein anderer Aspekt ist einfach: Es wird nicht besser und der Oxygenierungsindex bewegt sich kleiner 100 mmHg – damit ist ein schweres ARDS definiert, der Oxygenierungsindex ist kleiner 100 – und wir nähern uns mit dem Oxygenierungsindex tatsächlich eher der 80 und kleiner. Da muss ich ja irgendeine Option haben und es gibt die ECMO-Therapie. Das bedeutet, dass ich extrakorporal eine Oxygenierung des Patienten durchführe. Das wird in Zentren durchgeführt. Dann muss ich einfach mit dem Zentrum Kontakt aufnehmen und jedes Krankenhaus wird in seiner Nähe irgendwo ein ECMO-Zentrum haben oder es vielleicht auch selber durchführen. Dann muss ich daran denken: “Okay, das ist vielleicht ein Patient, für den eine ECMO interessant wird.” Ich sollte dann einfach Kontakt mit dem ECMO-Zentrum aufnehmen, sodass ich mir anschaue: “Okay, was sind die Hinweise des Kollegen oder der Kollegin vor Ort?”, was sie sagen würden, was man an der Beatmung erst mal noch eskalieren oder verändern könnte? Und dann sagen mir die Kollegen: “Ist das überhaupt ein Patient oder eine Patientin, für die eine ECMO-Therapie infrage kommt?” Das machen die an ganz speziellen Gesichtspunkten fest. Das müssen nicht diejenigen wissen und entscheiden, die jetzt keine ECMO betreiben, aber: einfach rechtzeitig mit den Kollegen Kontakt aufnehmen! Vielleicht haben die noch sehr gute Hinweise, wie man die Beatmung verbessert, und man erspart dadurch die ECMO-Therapie oder auch die Verlegung. Es wäre ja auch sinnlos, den Patienten einfach nur in ein anderes Zentrum zu verlegen, die machen das gleiche, nämlich invasive Beatmung, verändern nur die Beatmung ein bisschen und es wird besser. Also da einfach dann Kontakt aufnehmen und fragen: “Ist das eine Indikation? Was kann ich noch aus eurer Sicht verbessern?” Und dann werden die Kollegen mich schon beraten.
AMBOSS: Okay, ja gut, das sollte jeder Arzt einfach im Kopf haben, weil man ja immer Alternativen oder Varianten haben muss. Ist der Kontakt zum ECMO-Zentrum quasi die letzte Eskalationsstufe?
Junge: Ja, genau, das ist etwas, was man eher im Tagdienst bespricht, als dass man sich nachts eine Nummer raussuchen muss, dass man sagt: “Okay, wer ist eigentlich unser nächstes ECMO-Zentrum und wen rufe ich da eigentlich an?” Das ist etwas, was man gut vorbereiten kann, diese Nummer irgendwo parat zu haben. Das ist ja nicht so, dass man sagt, das ist eine Notfallnummer, ich muss den- oder diejenige in zwei Minuten erreichen können, aber dass ich vielleicht auch einfach vorher mit meinen Oberärztinnen und Oberärzten spreche: "Wer ist unser Ansprechpartner? Nachdem ich nachts mit euch Kontakt aufgenommen habe, wie rufe ich dann wo an? Und was sind das für Fragen, die sie mir stellen, damit ich schon mal vorbereitet bin und dann nicht sage: “Ach so, ich hole mal kurz die BGA.” Ja, das sind ja auch Dinge, mit denen man dann vielleicht selber glänzen möchte.
“Ich relaxiere den Patienten nur, wenn er permanent gegen das Beatmungsgerät presst.”
AMBOSS: Ja, definitiv. Was auch wichtig ist, du hast ja auch schon gesagt: Die Beatmungssituation allein ist ja nicht das einzige, was bei der Verbesserung des Patienten eine Rolle spielen kann, Stichwort: begleitende Therapie. Also, ich muss mich natürlich auch um die Hämodynamik kümmern, den Flüssigkeitshaushalt. Wie sieht es aus? Ist eine antibakterielle Prophylaxe angesagt? Ist eine Cortisontherapie angesagt? Vielleicht kannst du dazu noch von intensivmedizinischer Seite Stellung nehmen.
Junge: Ja, fangen wir vielleicht erst mal mit dem Patienten an, der jetzt eine Narkose hat und gleich in Bauchlage liegt. Der Patient soll von der Sedierungstiefe her so sein, dass er seine Beatmung gut akzeptiert. Das heißt, wir sprechen davon, dass er auf Ansprache womöglich die Augen öffnet, aber er soll sich nicht spontan bewegen können. Es kann gut sein, und da sprechen wir von der Synchronisation mit dem Beatmungsgerät: Es gibt Patienten, die kannst du so tief sedieren, wie du willst, die pressen gegen die Beatmung an, die akzeptieren das einfach nicht gut. Das kann auch so sein, dass die Modalitäten des CO2-Wertes im Blut so hoch sind, dass der Patient immer wieder versucht, da “rein zu atmen” und einfach keine gute Synchronisation mit dem Beatmungsgerät zu schaffen ist. Dann bleibt natürlich als Option bei einem Patienten, der permanent presst, ihn zu relaxieren, nachdem ich die Sedierungstiefe ausgereizt habe. Ich mache das nicht pauschal. Ich mache das nur, wenn ich ein Problem habe, dass dieser Patient immer wieder anfängt, gegen das Beatmungsgerät zu pressen und ich ihn einfach nicht gut mit meinem Beatmungsgerät synchronisiert bekomme. Dann kann ich ihn kontinuierlich relaxieren und das kann ich für 24–48 Stunden ausreizen. Und dann schaue ich, wie es danach läuft. Vielleicht ist die Beatmungssituation schon deutlich besser geworden. Der Patient liegt jetzt auf dem Rücken, ist mit dem Oberkörper hoch, toleriert den Tubus besser und presst nicht mehr entgegen. Aber ich relaxiere nicht pauschal. Das ist ganz wichtig. Aber wenn er es benötigt, kann ich es versuchen.
Der nächste Punkt ist, was du fragtest: die antibakterielle Prophylaxe. Prophylaxe – das Wort impliziert ja, dass ich nicht davon ausgehe, dass der Patient jetzt eine bakterielle Infektion hat, sonst würden wir ja von einer antibakteriellen Therapie sprechen. Prophylaxe? Nein. Wenn ich sage, das ist vermutlich eine Superinfektion der COVID-19-Infektion, dann mache ich eine antibakterielle Therapie, aber keine Prophylaxe im Sinne von: Er könnte ja eine bakterielle Pneumonie entwickeln. Das nicht, das wäre schlecht.
Der nächste Punkt wäre: pauschale Cortisontherapie. Auch das fällt weg. Nein, machen wir auch nicht, Cortison bedeutet immer eine Unterdrückung des Immunsystems und macht mir ganz andere Probleme. Wenn ich einen Patienten mit einer Virusinfektion habe, dann wird die Bekämpfung des Virus eben nicht besser. Und man muss ja sagen, eine der Hauptsäulen auch der ARDS-Therapie ist nun mal die Kausaltherapie und den auslösenden Faktor zu therapieren. Wir haben keine Therapie für das Virus selber. Das heißt, wir müssen dem Körper die Zeit herausarbeiten, es selber zu schaffen. Und wenn wir ihm jetzt Cortison dazugeben, dann verzögern wir diese Kausaltherapie. Es wäre etwas anderes bei einer bakteriellen Pneumonie. Da ist eine Kausaltherapie tatsächlich die antibakterielle Therapie. Aber das haben wir hier nicht.
Und dann kann man sich überlegen: Okay, Spasmolytikatherapie, sprich, die Bronchien zu erweitern. Auch das nur, wenn der Patient oder die Patientin spastisch ist. Also, es kann jemand mit vorbestehendem Asthma, COPD sein oder ich sehe es so, dass sich jetzt eine Bronchospasmik entwickelt. Ja, die therapieren wir, aber nicht pauschal, weil die pauschale Applikation von Spasmolytikatherapie eine Übersterblichkeit machen kann.
“Ich sollte eine Negativbilanzierung des Patienten versuchen.”
Und jetzt haben wir von ganz vielen Dingen gesprochen, die ich nicht machen soll oder auch nur machen soll, wenn ich dafür einen Hinweis habe, dass es so ist. Was ich versuchen sollte, wäre eine Negativbilanzierung des Patienten, sprich: dem Patienten Flüssigkeit zu entziehen, eine forcierte Diurese. Das kann ich natürlich nur machen, wenn die Hämodynamik ein Stück weit mitspielt. Also, bei einem Patienten, der eine Hypovolämie hat, weil er gerade auch einen septischen Schock mit Capillary Leak hat, also noch weiterhin bestehenden Endothelschaden, und immer wieder Volumensubstitution braucht, wird es schwierig, eine Negativbilanz anzustreben. Aber ein Patient, der vermeintlich nur noch eine Vasoplegie hat und mit Noradrenalintherapie einen stabilen Blutdruck aufbauen kann – oder sprechen wir besser von einem stabilisierten Blutdruck – da kann ich natürlich eine Negativbilanz testen. Also sprich, da kann ich mit Schleifendiuretika schauen: Okay, schaffe ich es, den Patienten peu à peu negativ zu bilanzieren, kann ich die Flüssigkeitszufuhr restriktiv gestalten? Das heißt, ich muss ja nicht einem 80-Kilo-Patienten zweieinhalb Liter kristalline Infusionslösung zuführen. Ich versuche einfach Schritt für Schritt, ihn negativ zu bilanzieren.
Wir erinnern uns: Es ist ein Ödem in der Lunge, und je weniger Flüssigkeit, also freies Wasser, sag ich mal, im Blut ist, desto eher wird das Wasser aus der Lunge rückresorbiert werden. Das hat einfach was mit osmotischen Kräften zu tun. Das heißt, wenn möglich, strebe ich eine Negativbilanz an. Nicht pauschal dem Patienten viel Volumentherapie anbieten. Es sei denn, ich kann nachweisen, er ist intravasal hypovoläm. Das kann ja sein, dass ich die Vena cava geschallt habe, dass ich ein Echo vorweg gemacht habe und sehe: “Okay, er hat einfach einen Volumenbedarf, warum auch immer.” Das will ich ihm natürlich nicht zwingend vorenthalten, aber ich versuche, so wenig wie möglich zu machen. Da muss ich mich am Laktat orientieren, an der Rekapillarisierungszeit. Das sind so Dinge, die ich dann mit reinbringen muss, aber tendenziell eine Negativbilanz.
AMBOSS: Okay, ich habe jetzt den Eindruck: auch da erst mal vorsichtig. Vielleicht kannst du ja so ein bisschen einen Rahmen angeben. Ich taste mich natürlich erst mal ran und bilanziere ihn nicht gleich mit minus einem Liter negativ.
Junge: Ja genau, es kommt natürlich extrem darauf an, wie die Hämodynamik ist, wie groß der Patient ist. Bei einer 1,40 Meter großen Frau mit 40 Kilo ist ein Liter halt etwas anderes, als wenn du jemanden hast, der männlich und 1,95 Meter groß ist. Das ist gar nicht zu pauschalisieren, sage ich jetzt mal. Wenn du eine zierliche Person hast, die keine massive Einschränkung der Hämodynamik hat, ist natürlich schon was gewonnen, wenn du irgendwie 400, 500 mL Negativbilanzierung hinbekommst. Wenn du jemand Großes hast, ist vielleicht eher die 800 mL oder 600 mL anzustreben. Aber jeder Milliliter, den du erst mal negativ bilanzierst, bedeutet ja, dass keine Positivbilanz stattgefunden hat. Das ist ja auch schon mal gut. Also, wenn ich die Positivbilanz verhindere, ist das schon mal der erste Schritt.
Und dann kann ich gucken: “Okay, wie arbeite ich mit der Restriktion meiner Volumentherapie, die ich dem Patienten zuführe? Was scheidet der Patient selber aus? Bilanziert er sich womöglich selber negativ?” Und dann kann ich schauen: “Okay, muss ich vielleicht Schleifendiuretika dazu nehmen, um vielleicht eine Negativbilanz hinzukriegen?” Aber ich sage mal, in 24 Stunden sind bei einem nicht hämodynamisch kompromittierten Patienten wahrscheinlich die 400, 500 mL gut zu machen. Vielleicht kann ich sogar ein bisschen mehr schaffen, wenn ich mir die Hämodynamik gut anschaue.
“Es darf keine Challenge sein, den PEEP zu reduzieren”
AMBOSS: Ja, das war schon mal ein guter Überblick für die begleitende Therapie, sodass ich weiß, was ich machen kann und was nicht. Das meiste, was wir jetzt angesprochen haben, sollte ich bei unserem COVID-Patienten definitiv lassen. Es sei denn, es sprechen spezielle vorliegende Faktoren beim Patienten dafür. Benjamin, hast du noch einen abschließenden Tipp an unsere Ärztinnen und Ärzte draußen für die Beatmungssituation, was du in deinem Alltag mit den Kollegen siehst, was häufig falsch gemacht wird, was wohl häufig nicht verstanden wird?
Junge: Es gibt zwei Dinge, die mir so ad hoc einfallen. Wir haben ja davon gesprochen: Wir wollen einen hohen PEEP einstellen und können dann danach FiO2 reduzieren. Was mache ich denn eigentlich, wenn der Patient besser wird? Die Oxygenierung wird also besser. Was soll ich dann als Nächstes verändern? Das Allererste, was ich reduziere, ist FiO2, damit ich so schnell wie möglich da runterkomme, sodass ich bei 0,4 – also 40 Prozent Sauerstoffanteil – ankomme. Das ist schon mal gut. Dann kann ich anfangen zu überlegen: Reduziere ich langsam den PEEP? Man kann sich vorstellen, wenn ich einen Patient mit einem 14 Millibar PEEP beatme, dann darf das keine Challenge sein, innerhalb von 8 Stunden in meiner Schicht den PEEP auf 6 runterzudrehen. Das Einzige, was passieren wird, wenn der Gegendruck in der Alveole fehlt, ist, dass sich das Ödem ganz schnell neu ausbilden wird. Das heißt, ich beginne einfach langsam, den PEEP zu reduzieren. Wenn ich beim 14er-PEEP wäre und ich eine FiO2 von 35 Prozent habe, dann kann ich mal um 2 Punkte, 2 Millibar den PEEP reduzieren und schau mir dann einfach an: Okay, wie hat sich das innerhalb der Schicht entwickelt? Und dann kann die nächste Schicht innerhalb der nächsten 8 Stunden eventuell noch mal um 2 Millibar reduzieren, wenn sich das kontinuierlich weiter so hält. Aber keine falsche Challenge zu sagen: Ich muss den PEEP ruckzuck wieder auf 6 runter gebracht haben, damit ich zeige, wie gut es diesem Patienten jetzt geht – und 3 Stunden später hat er wieder seine Oxygenierungsstörung. Damit wäre keinem geholfen und das wäre auch nicht das Ziel.
Was man manchmal auch sieht, ist so ein bisschen abhängig von der Körpergröße des Patienten. Nehmen wir uns mal eine Frau, eine zierliche Frau mit 1,50 Meter, die soll für die Lungenprotektion ein Tidalvolumen von 260 mL haben. Da kann es manchmal sein, dass es mit der Decarboxylierung schwierig wird, sprich: das CO2 loszuwerden. Was häufig am Ende des Beatmungsschlauches noch angeschlossen wird, ist eine sogenannte “Gänsegurgel”. Das ist das Verbindungsstück zwischen dem Tubus und dem Beatmungsschlauch. Und das ist Totraum. Das bedeutet, dieser Bereich der Luft wird nur hin und her bewegt und nimmt aber nicht am Gasaustausch teil. Das können je nach Hersteller mal zwischen 15 und 25 mL sein. Man kann sich vorstellen, wenn das bei einer Frau ist, die 260 mL Tidalvolumen haben soll, kann das mal ruckzuck fast 10 Prozent sein. Das heißt, wenn ich eine Decarboxylierungsstörung habe, entferne ich auch einfach mal die “Gänsegurgel”, um zu gucken, ob das noch eine Stellschraube war, an der ich drehen konnte, wenn ich die Beatmungsfrequenz schon ausgereizt habe. Das sind, glaube ich, so wichtige Punkte.
“Damit können wir die Überlebenswahrscheinlichkeit unserer Patienten verbessern.”
Und ich denke, als abschließende Variante muss man sich einfach für die Beatmung eines ARDS-Patienten immer in den Kopf rufen: die 6 mL pro Kilogramm Körpergewicht, gerne aus der Tabelle abgelesen – das ist ein Dogma, von dem ich erst abweiche, wenn ich meine Blutgasanalyse-Zielwerte nicht mehr einhalten kann –, die Druckdifferenz von kleiner 15 Millibar, der Beatmungsspitzendruck von kleiner 30, und einen höheren PEEP wählen, damit ich ein geringes FiO2 gewährleisten kann. Und dann das A und O, und das wissen wir, dass das zu selten gemacht wird, weil man doch Sorge hat, sich dafür zu entscheiden, ist: Wenn der Oxygenierungsindex – bei einem guten PEEP, sprich über 10 – kleiner 150 bleibt, dann muss der Patient oder die Patientin um 180 Grad auf den Bauch gedreht werden und dann muss das einfach für 16 Stunden durchgeführt werden. Das sind die evidenzbasierten Dinge, mit denen wir die Überlebenswahrscheinlichkeiten unserer Patienten verbessern können.
Dr. med. Benjamin Junge ist Intensivmediziner und Mitbegründer des Vereins Campus für Intensiv- und Notfallmedizin e.V. (CIN e.V.).
Mehr Informationen zum Thema COVID-19 sowie ARDS inklusive einer SOP zur Bauchlagerung bei ARDS sind auf AMBOSS zu finden.
Hier finden sich Flowcharts und Checklisten von CIN e.V.